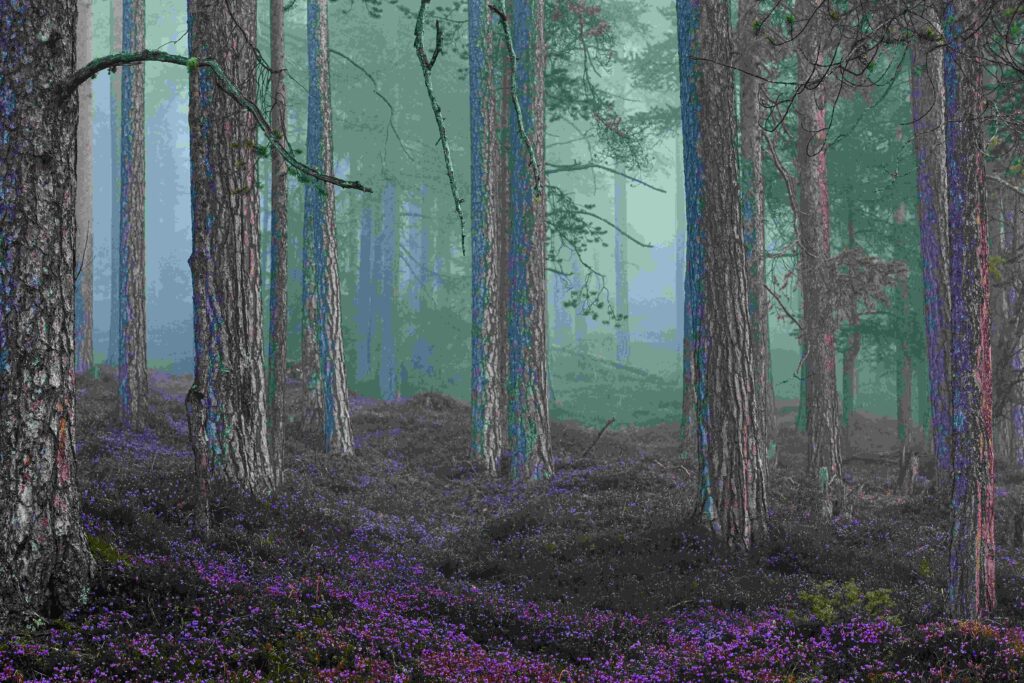Weinfall - Flurnamentafel © Johannes Ortner
Aus der Bergeerleben-Serie zu den Südtiroler Berg- und Flurnamen
von Johannes Ortner (Bergeerleben 2/2024)
Zu den prägenden geografischen Namen gehören nicht nur Felder, Wiesen, Wälder, Almen, sondern auch die Wegenamen, in der Fachsprache Hodonyme (altgriechisch hódos „Weg“ und ónyma „Namen“) genannt. Zu den Hodonymen zählen Straßen- bzw. Adressenbezeichnungen, aber auch all die anderen Wege wie z. B. Themenwege, Forstwege, verwachsene Mühlsteige oder die gepflasterten Ziehwege. Fußwege bilden einen wichtigen Teil innerhalb der Toponymie, denn in früheren motor- und straßenlosen Zeiten wurden sie in der Spanne eines Menschenlebens wohl Hunderte, ja auch Tausende Male beschritten. Die Lebenszeit von Generationen von Bergbauern ist an jeder abgetretenen Steinplatte ablesbar.
Mordergand & Lorggenloch
Wege sind Kommunikationsnetze. Der auf den Berghöfen erwirtschaftete Überschuss (Käse, Speck, Eier) wurde auf Fußsteigen zu Tal geschafft und auf dem Markt in bare Münze verwandelt. Damit wurden Salz, Genuss- und Heilmittel eingekauft.
Auch der Wein musste mühsam in Zummen und Yhrn zu den hohen Berghöfen „hinaufgebuggelt“ werden. Am Totengassl im Vellauer Wald kennt man gleich 3 Weinråschtn („Weinrasten“), wo man die 80 kg schwere Yhr absetzen musste, um die „Kripp“ zu entlasten. Auf dem Weg von Naturns aufs Patleider Egg kommt man an der Örtlichkeit Weinfåll vorbei, wo in einem unaufmerksamen Augenblick die wertvolle Fracht in die Tiefe stürzte.
Auf den Mühlsteigen wurde das tägliche Brot als Korn in die Bachgräben hin- und als Mehl wieder weggetragen – und auf den Almwegen wurde mit dem Vieh „gefahren“, im Juni bergan und im September bergab.
Auf den Wegen spielte sich aber nicht nur wirtschaftlicher Austausch ab. Wege haben auch eine wichtige soziale Funktion, angefangen beim Schulweg, den die Schüler gemeinsam bis zur „Wegscheide“ beschritten. Wege sind Orte der sozialen Interaktion, des Tratsches und der Information.
Heute sind die alten Plattenwege eine Art Outdoor-Fitness-Studio geworden und heißen neudeutsch Speed-Hiking-Trail. Einer der bekanntesten ist der Sunnseitnweg zwischen Burgstall und Vöran. Solche Wege haben eine sportliche Funktion erhalten – heute werden Kalorien dort verbrannt, wo man früher versuchte, solche zu sparen …
Das Wegenetz am Berg war feinnervig verästelt. Von den zerstreut liegenden Berghöfen verliefen kleine, unscheinbare „Zubringer-Wege“ zu den Hauptwegen, den Kirchsteigen. Die Kirchwege, wie z. B. der Schnatzeregger Kirchsteig zwischen Naturns und dem Berghof Schnatz, waren Hauptschlagadern mit semantisch aufgeladenen Knotenpunkten. An diesen Verdickungen trugen sich Begebenheiten zu, die zu einem Namen führten: Was verbirgt sich unter der Mördergand oder im Lorggenloch? Was kann man an der Weiberrast erfahren? Warum heißt dieser unscheinbare Platz im Lärchenwald „Bei der Ogrampm Milch“ („Bei der abgerahmten Milch“)? Diese Rastplätze des Körpers und Schweifplätze der Gedanken sind auch heute noch im kollektiven Gedächtnis der Dorfbevölkerung fest verankert.

Gasse, Zaine, Trai
Grundwort für den von Zäunen und Hecken eingefassten Fußsteig und Viehtriebweg ist die Gasse (mundartlich Gåss, Gåsse; häufiger Hof- und Familienname) mit der lateinischen Entsprechung vicus „Gasse“. Das alpenromanische *vı-cu führte zum Latscher Ortsteilnamen Zafig (*sub vı-cu „Untergasse, Unterdorf“) und zum Villnösser Hofnamen Vikol „Anwohner einer Gasse“ (Ausgangspunkt des Familiennamens Vikoler).
Im Pustertal wird statt „Gasse“ der Begriff Zäune (mda. Zaine) gebraucht. Im Zuge einer Metonymie wird der Begriff Zaun auf den mit diesem in engem Bezug stehenden Weg übertragen. Beispiele für Pusterer Zaine sind die Åntlasszaine in Pfalzen (Prozessionsweg zu Fronleichnam) und die Nöcklzaine in Ahornach.
Uralte Begriffe für einen Viehtriebweg sind Trai, Traien, Troidn, Truidn, Troile, ladinisch troi bzw. tru (vgl. dazu die zahlreichen Hof- und Familiennamen wie z. B. Troi, Trojer oder Troyer). All diese Wörter wurzeln in der indogermanischen Verbform *dreu- „laufen“, die zum Ausgangspunkt für das vorrömische Substantiv *trogilo „Viehlauf“ wurde.
Beispiele für einen Traiden ist der Aichhorner Traiden (mda. Åchenar Traidn) am Riedelsberg im Sarntal und der berühmte Troi Paian in Gröden. Das alpenromanische *trogju wurde übrigens zum Ausgangspunkt der Mengenbezeichnung *drozzo („Ansammlung von Wegen“) wie er uns im Flur- und Adressennamen Trotz in Seis entgegentritt.
Hohlwege
Hohlwege liegen wie in die Landschaft eingebettet, gesäumt von Rainen, Trockenmauern und hohen Hecken. In Lengstein am Ritten kennt man z. B. den Schwoager Houln („Schwaiger Hohlen“), ein jetzt asphaltierter Feldweg, der nach dem geschichtsträchtigen Dorfgasthof „Schwaiger“ benannt wurde. Im Alpenromanischen gibt es die Basis *cava-da, um eine Vertiefung auszudrücken. Beispiel dafür ist der Flurname Gfouda, womit ein markanter Bachgraben in Latzfons, aber auch die reizvolle Wiesensenke entlang des Wegs zwischen Unterfinser und Lajener Ried (Lajen) sowie zwischen Vill und Nauders in Rodeneck bezeichnet wird.
Anstiege
Ein steiler Wegabschnitt wird mundartlich häufig als Stich bezeichnet. Auch in diesem Fall gibt es Parallelen im Alpenromanischen: Die beiden markanten Straßensteigungen zwischen Ums und Prösels sind bei der lokalen Bevölkerung als Kleine und Große Patoia bekannt. Eine steile Wegstelle in den Kalterer Weingütern von Barleit wird als Pontara bezeichnet. Zusätzlich gibt es im Vinschgau das Begriffspaar Patoar und Pinggér, womit die kleineren Verbindungswaale zwischen den Tragwaalen bezeichnet werden. All diese Flurnamen leiten sich von alpenromanisch *punctuaira „Anstichstelle“ (zu lat. punctum „Stich“) ab.
Steile Wegstellen nennt man im ganzen Land aber auch Stickl (mda. schtickl „steil“). In Schenna ist das Stickle Gassl immer noch die kürzeste Fußverbindung in die Kurstadt Meran und wenn man von Kastelruth hinauf nach Tiosels wandert, muss man nacheinander das Lusner, Wieser und Nigglaler Stickl überwinden!
Der verbreitete Hofname Gstoag (mda. Gschtoag; Algund, Marling, Kalditsch, Salurn) bedeutet „steiler Wegabschnitt, Anstieg“ und leitet sich aus dem Mittelhochdeutschen „daz gisteigi“ ab. Aus den beiden Bestandteilen „gâch“ und Stich („jäher Stich“) setzt sich der Pusterer Hofname Gåsteig bzw. Gåstig zusammen, der auch zum Hof- und Familiennamen („Großgasteiger“; Mühlwald) wurde.
Stutz ist im Vinschger Oberland und im Oberen Gericht die Bezeichnung für eine steile Wegstelle, wie z. B. im Falle des „Zapplstutz“ und des „Lörgetstutz“ oberhalb von Tendres in der Katastralgemeinde Reschen.
Steile Fuhrwege wurden bei schlechten Witterungsverhältnissen für Zugtiere zur Tortur, der sie nicht immer standhielten. Nur so ist der häufige Flurname Ochsentod zu erklären. Der schönste Plattenweg, der diesen Namen trägt, befindet sich in Algund und ist Teil des mittelalterlichen Burgwegs zwischen Partschins und Schloss Tirol. Alle 14 in Südtirol dokumentierten „Ochsentod-Wege“ liegen im Westen des Landes – im Osten hat man die Ochsen scheinbar schonender behandelt. Im Partschinser Zieltal kennt man außerdem einen Mulli- und einen Fåckentod.

Gefährliche Wege
Aus vielen Wegenamen lässt sich die Exponiertheit heraushören, denn die Namengeber waren bestrebt, im Namen gleich eine Warnung mitzugeben. Felsige Wegpassagen heißen häufig Klåpf (im Pustertal ist Klåpf heute noch das übliche Wort für einen Felsen). Gefährliche Stellen wurden Böstritt oder Bösplått, felsige Fußwege Katzenleiter genannt (vgl. dazu Bergeerleben 03/21)! Gefährliche Stellen beim Heuziehen wurden auch toponymisch markiert: So erhielt eine steile und enge Kurve beim Eartlgraben oberhalb von Sennen (Ridnaun) die Bezeichnung Gåsser-Sorge, denn genau dort konnte der „Haifåcke“ leicht umkippen und mitsamt seiner Fracht in den Graben stürzen. Eine Erwähnung wert ist auch der Wegname Schlipf für „schlüpfrige“ (rutschige) Straßenstücke. Wie viele Fuhrmannsflüche sich wohl die Kortscher Schlipf (von Schlanders steil hinauf nach Kortsch) oder die Schlipf von Stufels hinauf nach Kranebitten angehört haben muss?
Ströb- und Holzwege
Die wichtigen Berg-Tal-Verbindungen wurden „gepflastert“, um der starken Beanspruchung und der Auswaschung durch Regenfälle Herr zu werden. Die altehrwürdigen Steinplattenwege (mda. Pflåschter) sind Kulturdenkmäler! Ein schönes Beispiel für einen gepflasterten Waldweg ist das Zmailer Pflaster in Schenna. Dieser Waldweg diente früher dem täglichen „Strëpziachn“ (Bringung der Stallstreu). Dadurch bildeten sich in Folge des Blockierens der metallbeschlagenen Räder mit dem Schrepfer die sogenannte Loasn („Rillen“). Auf dem Salten kennt man noch das Bettelpflaster, das einst der Pettl (= „Teufel“) während des Betläutens mit weißen Steinen gepflastert haben soll …
Weg- und Viehscheiden
Ganz besondere, ja symbolträchtige Orte sind Abzweigungen, die man in der Mundart nach wie vor Wegscheiden nennt. Auch hier findet sich eine romanische Parallele, nämlich *vie-du „Kreuzung, Wegscheide“, wovon sich der Steinegger Hof- und Familienname Vieid ableitet. Außerdem haben die Flurnamen Tschernay (Barbian), Tschonnadui (Almweide unterm Puflatsch, Kastelruth) sowie Tschadldui (Tiers) ihren Ursprung im Alpenromanischen *tšernaira bzw. *tšernadoriu „Viehscheide“ (zu lat. cernere „scheiden, trennen“).
Kurven
Kehren und Kurven eines Weges werden gerne benannt. Das Grundwort für „Kurve, Wendung, Biegung“ lautet in den vielen mundartlichen Varianten Rid, Ride, Rai, Raide, Rip und Ri. Am Weißensteiner Wallfahrtsweg unterscheiden die Leiferer z. B. die Köfele-Rai, die Brunner-Rai und die Feichten-Rai. Auch die Kehren der Passstraßen erhielten mancherlei Benennungen. Ganz genau nahmen es die Trafoier, denn alle 48 Kehren der Stilfser-Joch-Straße haben ihren eigenen besonderen Namen, darunter so sprechende wie das Jüngste Gericht (Kehre Nr. 9) und das Süße Löchl (Kehre Nr. 10). Ersteres ist übrigens Folge des zweiten …
Humorvolles
Wie man an der Jahrhundertstraße übers Stilfser Joch sieht: Im Angesicht großer Gefahr wird gerne gescherzt – Galgenhumor eben. Zwischen dem Nocker und Maggner in Wangen am Ritten führte einst ein schwindelig hoher und wackeliger Steg über den Hintermigler Bach, der von einem Wanderer erst dann begangen worden sein soll, nachdem er vorher sein Testament verfasst hatte – von da an erhielt der Steg die Bezeichnung Testamentbrüggl. In Salurn führt ein äußerst steiler Weg durch die „Cròzi“ hinauf zum Unternotdurfter (Pomaròl). Er wird Basa cul (frei übersetzt „Arschbusser“) genannt, weil man beim Aufstieg den Hintern des Vordermanns immerzu vorm Gesicht hatte. Zu guter Letzt verdient der steile Straf-Gottes-Weg zwischen dem Moarhäusl in der Sarner Schlucht und Afing eine besondere Erwähnung. An einer Ri („Kurve“) steht das Tarneller-Bildstöckl. Es erinnert an den Vater der Tiroler Hof- und Familiennamenforschung Prof. Josef Tarneller, der dort beim Abstieg von der Sommerfrische in Kampidell in das heimatliche Kloster Muri-Gries am 2. Juli 1924 verschied.
Johannes Ortner, Sozial- und Kulturanthropologe

Beiträge rund ums AVS-Magazin „Berge erleben“